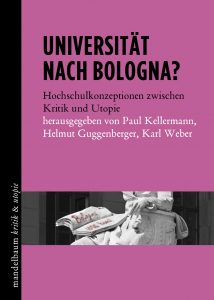Sowohl Wissen als auch Denken: Plädoyer für „et … et“
Der emeritierte Soziologe Paul Kellermann spricht im Interview über die Notwendigkeit von Selbstorganisation in der Studienorganisation und über die Folgen der Veränderungen im Universitätssystem. Kürzlich hat er gemeinsam mit Helmut Guggenberger und Karl Weber den Sammelband „Universität nach Bologna? Hochschulkonzeptionen zwischen Kritik und Utopie“ herausgegeben.
Wenn Sie heute 18 Jahre alt wären und in Mitteleuropa leben würden, welchen Werdegang würden Sie einschlagen?
Zuerst würde ich Erfahrungen in der Praxis sammeln. So habe ich es in meiner Jugend auch getan. Später würde ich dann – mit meinem heutigen Wissen – ein individuelles Studium zusammenstellen. Die Kombination von Schulbildung und körperlicher Arbeit scheint mir wichtig zu sein.
Warum würden Sie ein individuelles Studium wählen?
Für einen von anderen vorgegebenen Studienplan bin ich zu individualistisch. Dazu lege ich zu viel Wert auf das Selbst-Denken, als dass ich mich mit Wissen vollstopfen lassen würde.
Stopfen die Universitäten ihre Studierenden mit Wissen voll?
Ja, dieser Effekt ist ja auch mit dem Begriff Bulimie-Lernen beschrieben, also gerade nur für die jeweils nächste Prüfung lernen. In meinem Dissertantenseminar gibt es Studierende, die bereits Hunderte von Prüfungen abgelegt haben.
Wird der Mensch nicht durch Fleiß klüger?
Das ist überhaupt nicht der Fall. Klüger wird man nur durch Denken und Nachdenken. Einer meiner Grundsätze lautet: „et … et“, also „sowohl … als auch“. Mir geht es um Wissen und Denken. Derzeit herrscht im Bildungsbetrieb die Vermittlung von Wissen vor, das Denken ist nachrangig. Wissen kann man sich heutzutage jederzeit holen, aber was nützt das Wissen, wenn es nicht verarbeitet werden kann?
Studienpläne sollen sich ja darum bemühen, das Wissen sinnvoll zu gliedern und so eine Vermittlung zu organisieren.
Die Frage ist, wie der Begriff „sinnvoll“ verstanden wird. Für sinnvolle Pläne bin ich immer. Was mir widerstrebt ist die Einstellung, dass ältere Menschen aufgrund ihrer ganz persönlichen Erfahrungen Studierenden vorschreiben, was sie zu tun haben. Die Crux dabei: Die Älteren haben das, was da rauskommt, überhaupt nicht zu verantworten. Das müssen die Studierenden dann selbst, indem sie entweder erfolgreich werden oder nicht, glücklich oder unglücklich. Deshalb bin ich für weitgehende Selbstorganisation und Selbstverantwortung auch im Studium.
Welche Effekte hat das von Ihnen konstatierte mangelnde Denken im Studium auf die Gesellschaft?
Aufgrund des Denkens erfolgen bestimmte Handlungen. Wir Soziologen sprechen von „Handlungsorientierung“. Wenn an den Universitäten eine bestimmte Schulrichtung gelehrt wird, dann handeln Graduierte aufgrund dieser Orientierung bzw. dieser Ideologien oder Paradigmen.
Hat nicht jede Zeit ihre Ideologie und ihre Paradigmen, die weitergegeben werden?
Ja, da haben Sie recht. In den 1960er und 1970er Jahren bezog sich Kritische Theorie auf die Gesamtgesellschaft, wenn nicht gar auf die gesamte Menschheit. Heute sehe ich, dass die nationale Wirtschaft im Vordergrund steht. Dabei wird meines Erachtens der Gesamtzusammenhang nicht mehr genügend gesehen.
Haben Sie eine Erklärung, warum das der Fall ist?
Die Konkurrenz unter den Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern ist dermaßen groß, dass man nur eine Chance in der Scientific Community hat, wenn man sich auf einen ganz kleinen Bereich konzentriert, der sonst von niemandem bearbeitet wird. Das Denken in Zusammenhängen gerät dabei ins Hintertreffen.
Ihre Perspektiven sind pessimistisch. Sehen Sie auch einen Hoffnungsschimmer für die Universität?
Ich bin skeptisch. Je größer die Zusammenhänge real sind und nicht wahrgenommen werden, desto weniger lässt sich positiv etwas ändern. Schauen Sie sich z. B. die 28 EU-Länder an: Reformen sind schwierig, weil immer irgendjemand ein Veto einlegt.
Die „Europäische Universität“ gibt es seit 1088.
Es gab die „Europäische Universität“. Mit der Sorbonne-Erklärung wollte man 1998 den Studierenden Europa nahebringen und sie dazu ermuntern, andere Länder kennen zu lernen. Damals kam der Begriff „Employability“ erstmals vor. Man wollte es den Studierenden ermöglichen, als Graduierte auch in anderen EU-Ländern anerkannt zu werden und so auf den europäischen Arbeitsmärkten auftreten zu können. Mit dem Bologna-Prozess ab 1999 wurde diese Interpretation umgedreht. Zum Ziel wurde schließlich: „… to become the most competitive and dynamic knowledge based economy of the world.“ Nun ging es also um wirtschaftliche Konkurrenz in der Welt, wofür europäische Absolventinnen und Absolventen ausgebildet werden sollen.
Konkurrenz liegt unserem kapitalistischen und globalen System zugrunde.
Vor allem wirtschaftliche Konkurrenz. So wird in Europa seit etwa zehn Jahren, in Australien bereits länger, Universitätsbildung auch als Ware gesehen, als Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Der Blick auf Bildung hat sich verändert. Ursprünglich, bei Rousseau und Humboldt, bedeutete Bildung Persönlichkeitsentwicklung, heute soll sie auch als Ware zum BIP beitragen.
Das kann man doch auch als Vorteil sehen. Alles, was zum BIP beiträgt, wird nach diesem Wertesystem auch gefördert.
Wenn es das Ziel ist, durch Verkauf von Bildungsangeboten das BIP zu erhöhen, wird es nicht vorrangig sein, die Kreativität und Selbstorganisation, die Spontaneität und Selbstverantwortung von Menschen zu entwickeln.
Diese Werte könnten doch auch die Grundlage für wirtschaftlichen Wohlstand sein.
Sicher, sogar besser, wenn die individuellen Potenziale sich entfalten können. Das wäre der eigentliche Zweck von Hochschulbildung. Aber heute steht die wirtschaftliche Verwertung im Vordergrund, Hochschulbildung wird als Mittel gesehen.
Ist die Ausbildung junger Menschen nicht eine Aufgabe der Universitäten?
Ich rede nicht gegen Ausbildung. Die erste europäische Universität Bologna war vor über neun Jahrhunderten gegründet worden, um bessere Rechtskundige zu haben. Es ging also von Anfang an auch um Berufsausbildung. Deshalb ist mir dieses „et … et“ ja so wichtig. Es braucht Persönlichkeitsentwicklung und Berufsbildung, Theorie und Praxis. In einer „universitas magistrorum et scholarium“, also einer Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden, wie sich die Europäische Universität ursprünglich definiert hat, waren die Studierenden gleichberechtigt. Sogar die ersten Rektoren kamen aus der studentischen Gemeinschaft. Mittlerweile haben die Studierenden nicht mehr viel zu sagen und auch kaum noch Zeit sich einzubringen. Dazu und zum Denken gehört Muße.
Was muss passieren, damit wieder mehr gedacht wird?
Die Kommerzialisierung der Universitäten hat in Australien begonnen, nun nehme ich sie dort als rückläufig wahr. Auch in Oxford haben sich mehrere Professorinnen und Professoren zusammengeschlossen, um gegen die heutige Art von Studienorganisation zu protestieren. Schon 1999 wurde die Glion Declaration veröffentlicht, für die sich US-amerikanische Universitätspräsidenten und Schweizer Akteure getroffen haben und die für die klassischen Werte der Europäischen Universität eintraten. Aber das Problem sind die enorme Verwobenheit und der Zentralismus: Daher würde man zunächst nur in kleineren, geschützten Einrichtungen sinnvollere Universitätskonzepte entwickeln können.
Kellermann, P., Guggenberger, H. & Weber, K. (2016). Universität nach Bologna? Hochschulkonzeptionen zwischen Kritik und Utopie. Wien: Mandelbaum.